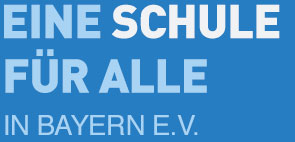Bulimielernen ist keine Bildung – sondern ein Systemfehler
Jahr für Jahr pressen Kinder Wissen ins Kurzzeitgedächtnis – und vergessen es nach der Prüfung wieder. Höchste Zeit, Schule neu zu denken: menschlich, inklusiv, gemeinschaftlich.
Lernen oder nur Bestehen?
Wenn man Bulimielernen googelt, findet man auf Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Bulimielernen):
„Unter dem Begriff Bulimielernen versteht man das kurzfristige Auswendiglernen von Fakten, Formeln, Sachverhalte, Wissen etc. für eine Prüfung, Klausur, Klassenarbeit oder einen Test, die man kurze Zeit danach wieder vergisst und dadurch meist nicht auf ähnliche Probleme mangels Übung und tiefgreifenderem Verständnis anwenden kann. Mit dieser Lernmethode besteht man zwar, der tatsächliche langfristige Lerneffekt ist jedoch gering bis gar nicht vorhanden. Es wird also primär das Kurzzeitgedächtnis anstatt das Langzeitgedächtnis trainiert.“
Mich beschäftigt dieses Thema seit Langem, und es hat mich sowohl meine gesamte Schulzeit als auch mein gesamtes Studium hinweg begleitet. Das Fatale daran: Ich habe es nicht bemerkt.
Ich dachte noch lange nach der Schule, dass ich mit meinen Abschlüssen auf dem Gymnasium und der Hochschule tatsächlich Bildung erlangt habe. Denn – wie von mir verlangt – habe ich gute Noten produziert, war eine gute Schülerin, habe in den überfallartigen Tests (Extemporale oder Stegreifaufgaben) oder bei mündlichen Abfragen gut bis sehr gut reproduziert, was verlangt wurde.
Dafür wurde schon mal morgens um sechs Uhr der Wecker gestellt, damit man sich die zwei Seiten im Erdkundebuch reinpresst oder die Jahreszahlen rund um die Weimarer Republik für den Test merkt.
Hinterher war das Ganze dann endlich nicht mehr wichtig – man konnte es vergessen und war erleichtert. Das war ja schon dran, wird also nicht mehr abgefragt.
Je höher die Klasse, je weiter im Studium, desto größer der Umfang des Stoffes, den man „auswendig“ zu lernen hatte – aber das Prinzip blieb gleich: Klausur, Prüfung, Abfrage überstanden – und schon war es nicht mehr wirklich wichtig.
Vor Schulaufgaben war deshalb die wichtigste Frage: Welche Themen kommen dran? Welche Seiten im Buch sind das?
Und wehe, die Lehrkraft wagte es, etwas anderes zu prüfen!
Man wird so sehr konditioniert, dass man überhaupt nichts anderes mehr lernen mag und sich dann sogar darüber aufregt, wenn etwas anderes dran kommt.
Wer aber trägt daran die Verantwortung? Die Schülerinnen, die für gute Noten gelobt werden und genau darauf lernen – oder die Lehrkräfte, die nach dem Lehrplan unterrichten und unter massivem Zeitdruck stehen?
Aus meiner Sicht sind beide Gefangene des Systems.
Denn es bleibt keine Zeit für echte Interessen. Haben Schülerinnen mal Fragen, heißt es oft: Dafür ist leider keine Zeit – wir müssen im Stoff weiterkommen.
Und wer etwas nicht versteht, hat kaum die Chance, das Thema auf anderem Weg zu begreifen.
Richtig frei lernen, entdecken, ausprobieren – das gibt es kaum.
Warum Bulimielernen so schädlich ist
Dieses System gaukelt Bildung nur vor. Es produziert Wissen auf Abruf – kein Denken, kein Verstehen, kein echtes Lernen.
Studien zeigen, dass ein Großteil des Schulwissens wenige Wochen nach einer Prüfung wieder vergessen ist.¹
Was bleibt, ist das Gefühl: Lernen ist anstrengend, fremdgesteuert, und hat mit dem eigenen Leben wenig zu tun.
Dabei ist echtes Lernen das Gegenteil davon: Es ist neugierig, emotional und sinnstiftend.
Bulimielernen trainiert nur das Kurzzeitgedächtnis – nicht das Verstehen, nicht die Fähigkeit, Wissen zu übertragen oder Neues zu entdecken.
Es nimmt Kindern die Freude am Denken und die Chance, Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit zu entwickeln.
Wie Lernen wirklich gelingt
Gutes Lernen braucht Zeit, Beziehung und Sinn.
Gute Schulen wissen: Lernen gelingt dann, wenn Kinder verstehen, warum sie etwas lernen. Wenn sie Fragen stellen dürfen, Fehler machen dürfen, wenn sie eigene Wege finden dürfen.
Wenn Unterricht Raum bietet für Projekte, gemeinsames Forschen, Kreativität – und wenn nicht die Note, sondern der Lernfortschritt zählt.
Ein paar Grundprinzipien, die helfen, Lernen neu zu denken:
-
Verstehen statt Auswendiglernen – Wissen vernetzen, anwenden, ausprobieren.
-
Zeit zum Vertiefen – Lernen darf dauern.
-
Vielfältige Lernformen – Gruppenarbeit, Projekte, eigenverantwortliches Lernen.
-
Rückmeldung statt Bewertung – Feedback, das stärkt, statt Noten, die blockieren.
-
Sinn und Relevanz – Lernen, das sich mit dem Leben verbindet.
So entsteht Lernen, das bleibt. Lernen, das trägt. Lernen, das Mut macht.
Schule neu denken – für alle Kinder
Genau das ist das Ziel, für das wir uns bei Eine Schule für Alle in Bayern e.V. einsetzen.
Wir wollen, dass Schule ein Ort des Lernens wird – nicht ein Ort des Prüfens.
Ein Ort, an dem Kinder gemeinsam wachsen, sich gegenseitig stärken, Fehler machen dürfen und wirklich lernen, wie Lernen funktioniert.
Dazu braucht es eine neue Haltung:
Schule darf kein Selektionssystem sein, sondern ein Entwicklungsraum.
Deshalb setzen wir uns für drei zentrale Veränderungen ein:
-
Inklusion – jedes Kind gehört dazu, mit seinen Stärken und Herausforderungen.
-
Gemeinschaftsschulen – längeres gemeinsames Lernen, mehr Zeit für Entwicklung.
-
Veränderung der Lernkultur – weg vom reinen Stoffdurchlauf, hin zu echtem Lernen.
Wenn Schule ein Ort wird, an dem Kinder ihre Fähigkeiten entdecken dürfen, an dem Lernen Freude macht und Beziehung zählt, dann hat sie ihre eigentliche Aufgabe erfüllt.
Über mich
 Christine Lindner ist Vorsitzende von Eine Schule für Alle in Bayern e.V. und leitet den Bereich Vertrieb und Marketing bei AS Computertraining (Erwachsenenbildung).
Christine Lindner ist Vorsitzende von Eine Schule für Alle in Bayern e.V. und leitet den Bereich Vertrieb und Marketing bei AS Computertraining (Erwachsenenbildung).
Seit vielen Jahren engagiert sie sich für Bildungsgerechtigkeit, die Einführung von Gemeinschaftsschulen und eine Lernkultur, die Kinder stärkt statt sortiert.
Ihr Motto: „Aufgeben ist keine Option.“
👉 www.eine-schule.de/ueber-uns/
¹ OECD Learning Compass 2030 – Future of Education and Skills: https://www.oecd.org/education/2030-project/